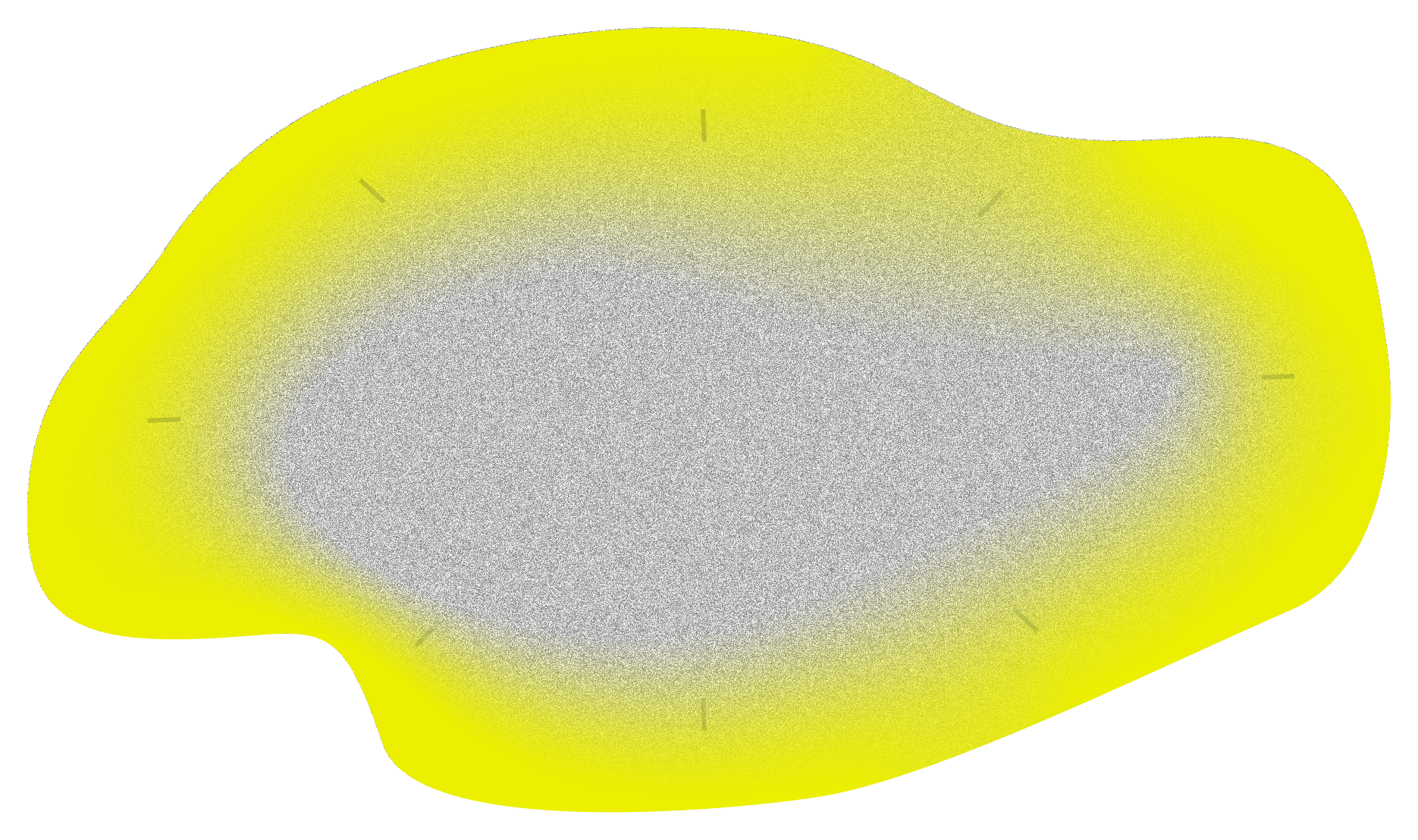
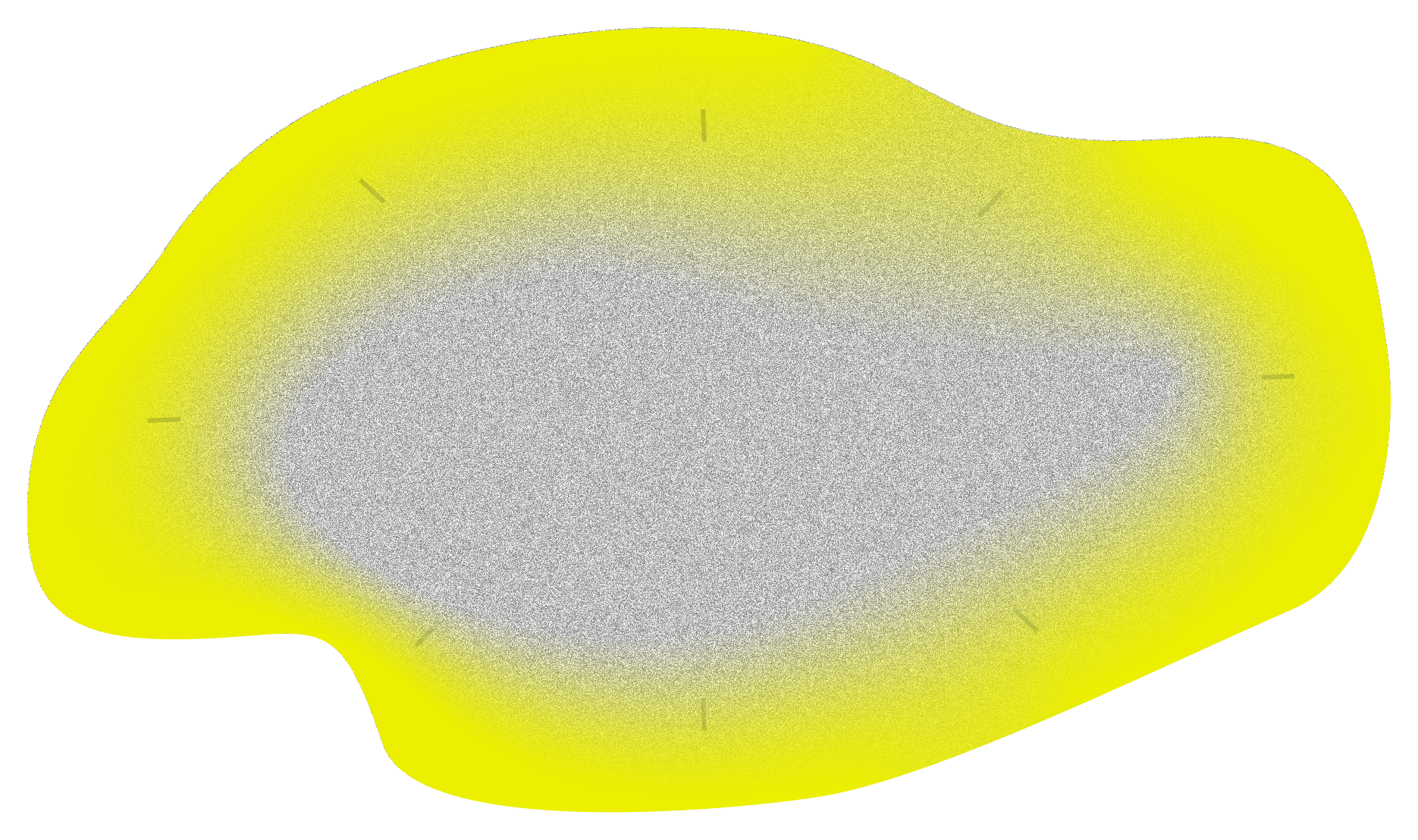
Lebenswerte Zukünfte gestalten
Inmitten von Klima- und Gesundheitskrisen, Fachkräftemangel sowie Ängsten vor Globalisierung und Digitalisierung steht die Schweiz vor grossen Herausforderungen.
Könnte weniger Arbeitszeit eine Antwort sein?
In Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen, der Zivilgesellschaft und Institutionen entwickeln Dezentrum und das Centre for Development and Environment (CDE) Szenarien für neue Arbeitszeitmodelle und führen Experimente durch.
Das Experiment: Bedingungsvolle Erwerbsarbeitszeitreduktion
Das Experiment: Bedingungsvolle Erwerbsarbeits-zeitreduktion
Im Rahmen des ersten Experiments des Projekts suchen wir Organisationen, die einem Teil oder ihrer ganzen Belegschaft während 6 bis 12 Monaten bezahlte Zeit für gesellschaftliches Engagement zur Verfügung stellen.
Ziel des Experiments ist es, zu prüfen, ob bezahlte Zeit für gesellschaftliches Engagement ein wirksames Mittel zur Bindung von Mitarbeitenden darstellt und zugleich auch Mitarbeitenden mit beschränkten Ressourcen aktive Teilhabe ermöglicht. Zudem wird untersucht, wie sich die bedingungsvolle Erwerbsarbeitszeitreduktion auf das Wohlbefinden der Belegschaft auswirkt.
Die Wirkung wird durch qualitative und quantitative Erhebungen untersucht.
Weil jede Organisation eigene Strukturen und eine eigene Kultur hat, gibt es nicht eine Lösung für alle. Deshalb haben wir verschiedene Modelle entwickelt – von festen Zeitkontingenten über ein kollektives Budget bis hin zu individuellen Pensenreduktionen – und passen diese spezifisch an jede Organisation an.
Interessiert?
Sie möchten als Unternehmen innovative Wege gehen, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dabei auch die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeitenden stärken? Ob Agentur, Gastrobetrieb, KMU oder eine andere Organisation: Wir freuen uns auf ein unverbindliches Kennenlernen!
Die folgenden Beispiele sollen als Inspiration dienen, wie eine Umsetzung aussehen könnte:
Über das Projekt
Klimakrise, soziale Ungleichheiten, Stress und Gesundheitskrisen sowie die Diskrepanz zwischen Fachkräftemangel und der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Offshoring und Automatisierung: Unsere Gesellschaft nähert sich sozialen, ökologischen und ökonomischen Belastungsgrenzen, die nicht zuletzt ein Umdenken in der Rolle der Erwerbsarbeit erfordern.
Studien und Beispiele zeigen, dass kürzere Erwerbsarbeitszeiten das Wohlbefinden fördern, ökologische Belastungen mindern und den sozialen Zusammenhalt stärken können.
Das Projekt EvA liefert diesbezüglich praxisnahe Impulse und wissenschaftliche Erkenntnisse für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Projektaktivitäten
• Entwicklung von wünschenswerten Zukunftsszenarien
• Erarbeitung und Durchführung von Experimenten, die in erster Linie KMUs adressieren.
• Wissenschaftliche Begleitung der Experimente
• Entwicklung eines Modells, das die Beziehungen zwischen Arbeitszeit, Wohlstand und Ressourcenverbrauch beschreibt – mit Schwerpunkt auf gesamtwirtschaftlichen Fragen und den Wechselwirkungen mit zentralen gesellschaftlichen Systemen (z. B. Sozialversicherungen).
Timeline
2024
2025
2026
Wünschenswerte Zukünfte entwickeln
Workshop Einflussfaktoren und Workshop Gelingensbedingungen
Experimente
Entwicklung
Durchführung
Diskurs
Begleitforschung
November 24 bis Februar 25
Wir entwickeln Szenarien für wünschenswerte Zukünfte.
März 25 bis August 26
Auf Basis dieser Szenarien entwickeln und führen wir Experimente durch, die auf KMUs, gesellschaftliche Veränderungen oder institutionelle Aspekte abzielen. Wir prüfen mit wissenschaftlichen Methoden, wie erwünscht diese Szenarien sind. Wir erstellen ein Modell, das Arbeitszeit, Wohlstand und Ressourcenverbrauch verknüpft und konzentrieren uns auf makroökonomische Fragen sowie Abhängigkeiten von wichtigen gesellschaftlichen Systemen (z.B. Sozialversicherungen).
September 26 bis Dezember 26
Mit unseren Erkenntnissen bereichern und prägen wir den Diskurs über Erwerbsarbeitszeitverkürzung und Zeitwohlstand.
Januar 24 bis Dezember 26
Wissenschaftliche Begleitung des Projekts und der Experimente
2024
Nov
Dez
2025
Jan
Feb
März
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
2026
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Über uns
Dezentrum
Das Dezentrum ist ein Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Er forscht, sensibilisiert und gibt Anstösse für Innovation. Dabei arbeitet das Dezentrum mit Universitäten, internationalen Allianzen sowie dem öffentlichen und privaten Sektor. Das Dezentrum versteht sich als Think Tank, der mutige Hypothesen aufsetzt und als Do Tank, der diese mit Experimenten testet und Impulse für wünschenswerte Zukünfte setzt. Immer mit dem Ziel: Eine digitale Transformation, die der Gesellschaft dient.

Centre for Development and Environment
Das Centre for Development and Environment (CDE) wurde 2009 als interdisziplinäres Forschungszentrum der Universität Bern gegründet. Sein Engagement besteht darin, innovative Ansätze in Forschung und Lehre voranzutreiben, um eine Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Zu diesem Zweck engagiert sich das CDE für soziales Lernen und für die Produktion von Wissen in mehreren Regionen der Welt, investiert in langfristige Partnerschaften und verbindet lokale Realitäten mit globalen Debatten.

Das Projektteam
Jeannie Schneider, Dezentrum
Mirko Fischli, Dezentrum
Sarah Bleuler, Dezentrum
Christoph Bader, CDE
Hugo Hanbury, CDE
Nicolà Bezzola, CDE
Stephanie Moser, CDE